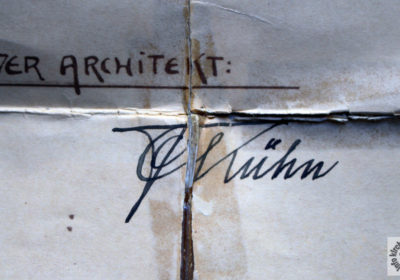- Stats: 314 0 0
- Author: Konstantin Manthey
- Posted: 12 Dezember, 2024
- Category: Aktuelles, Kalender
Ostensorium mit Hinterglasmalerein (XI.XII.)
Ein Ostensorium ist ein Schaugefäß. Der Begriff stammt vom lateinischen Wort: ostendere‚ d.h. soviel wie: entgegenhalten oder zeigen. In Gebrauch sind solche Gerätschaften seit dem frühen Mittelalter. Darin werden besondere Dinge gezeigt, denen eine große Verehrung zu Teil werden kann bzw. soll. Es gibt die verschiedenen Bauformen. Ganze Architekturen können nachempfunden werden. Vor allem nach 1200 haben Ostensorien den Anspruch dem Betrachter wirklich etwas zu zeigen. D.h. es gibt sie mit Glaszylindern bzw. Guckfenstern. Jedoch ist sehen damals nicht gleich sehen. Vielmehr reicht es meistens, dass die Menschen an die Wirksamkeit der darin verborgenen Heilstümer, meist Reliquien, also Überbleibsel von Heiligen, glaubten. Es ist davon auszugehen, dass nur wenige Menschen dem Gefäß bzw. dem Gegenstand so nahe kamen um es wirklich zu sehen. Gut möglich, dass es sozusagen geschaut wurde, durch den Glauben daran und das Wissen um die zugeschriebene Wirkmacht.

Über das Ostensorium im Berliner Kunstgewerbemuseum
„Das Ostensorium besteht aus zwei zu einer scheibenförmigen Kapsel montierten Goldglas-Medaillons mit Darstellungen der Maria mit dem Kind und der Kreuzigung Christi. Das Bild der Madonna wird von rot beschriftetem Pergament mit dem Verzeichnis der im Schaugefäß enthaltenen Reliquien umrahmt. Unmittelbar im Anschluss an ihre Nennung sind die jeweiligen Heiltümer selbst durch kleine Ausschnitte im Pergament sichtbar.“
Q: Lothar Lambacher: Objektbeschreibung, zu F2039, unter: https://id.smb.museum/object/1830647/ostensorium (Zugriff: 10.12.24)
Leider sieht man in der derzeitigen Aufstellung in der Übergangsschau der mittelalterlichen Schatzkunst die Seite mit der Maria nicht.
Die Reliquien im Berliner Ostensorium
Als Reliquien finden sich u.a. Partikel vom Heiligen Kreuz sowie Reliquien von Aposteln, Evangelisten und männlichen Märtyrern. Ebenso soll es Stücke der Gottesmutter geben sowie weiteren weiblichen Heiligen. Passend zu der Herkunft gibt es Teile des Gewands und Schleiers der hl. Klara (1193/94–1253). Darüber hinaus sind Reliquien männlicher Heiliger des Franziskanerordens nachweislich. Ebenfalls sind Partikel des hl. Franziskus (1181/82–1226) enthalten. Laut Lambacher ist das Berliner Stück vergleichbar mit Reliquiare welche für Franziskaner- oder Klarissen-Konvente bestimmt waren. Diese Stücke mit Goldglas-Darstellungen sind teilweise dem deutschen Frater Petrus Theotonicus (Profess 1288, in Assisi nachweisbar bis 1331) zugeschrieben. Dieses Ostensorium wird einem Konvent zugeschrieben, der um 1320 gegründet wurde. Somit ist die Entstehung in dieser Zeit wahrscheinlich.

Über die sichtbare Seite
Die Kreuzigungsszene weist wohl weichere Linien auf. Daher gehen viele Fachleute von zwei verschiedenen Künstlern aus. Zur Technik der Herstellung schreibt Lambacher außerdem:
Beide Goldgläser des Berliner Ostensoriums wurden in der später durch Cennino Cennini (um 1370–um 1440) beschriebenen Technik ausgeführt: Zunächst wurde auf die Rückseite des Glases mit Eiweiß eine Goldfolie geklebt, in welche die Zeichnung dann mit einer Nadel eingeritzt und schließlich durch Auftrag eines Farblacks hinterfangen wurde
Q: Lothar Lambacher: Objektbeschreibung, zu F2039, a.a.O.

Alle Bilder: K. Manthey 2024
Würdigung
Mir fiel das Stück in diesem Jahr erstmalig auf. Ebenso machte mich kurz darauf ein Kollegen darauf aufmerksam. Es ist wirklich faszinierend. Denn zum einen ist die Zeichnung auf der sichtbaren Kreuzigungsseite so filigran und fein und anmutig, zum anderen ist die Gesamtkonstruktion sehr schlicht und zurückhaltend. Hier hat man sich also anscheinend auch Gedanken über die Wirkung im franziskanischen Umfeld gemacht. Solch ein Stück sucht auch im Mittelalter seines gleichen. Vielen Dank auch an meinen Kollegen M. Rabe für den erinnernden Hinweis!
Links zum Ostensorium
Die Objektseite beim KGM:
https://recherche.smb.museum/detail/1830647/ostensorium
Über Ostensorien bei wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ostensorium